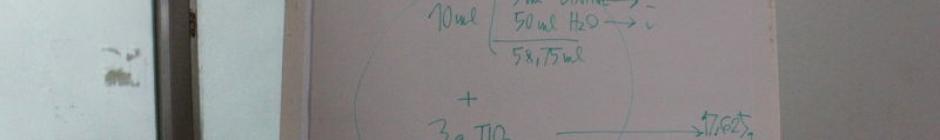Interview mit Felix Stalder über die Zukunft des Internets
Felix Stalder ist Dozent für Theorie der Mediengesellschaft an der Zürcher Hochschule der Künste und freier Autor und Organisator in Wien. Er beschäftigt sich mit dem Wechselverhältnis von Gesellschaft, Kultur und Technologien, insbesondere mit neuen Formen kultureller Produktion und räumlichen Praktiken. http://felix.openflows.com
Ushi Reiter: Durch den Fall Snowden erreicht das Thema »Internet als überwachter Raum« erstmals eine breite Öffentlichkeit. Dieser Vorfall und die Aufregung haben z.B. keine massenhaften Austritte aus dem sozialen Netzwerk Facebook bewirkt. Welche Auswirkung hat nun diese Erkenntnis der Kontrolle auf unser kulturelles und kommunikatives Handeln im Netz?
Felix Stalder: So lange es keine ernsthaften Alternativen zu den immer größer werdenden Teilen des Internets gibt, die als überwachte Räume fungieren, werden sich die Auswirkungen der aktuellen Diskussion auf das Handeln wohl in Grenzen halten. Cryptoparties und ähnliches sind eher symbolische Aktionen und solange die Infrastruktur für Überwachung optimiert ist, so lange wird es sehr komplex bleiben, nachträglich und individuell Privatsphäre zu schaffen. Und damit bleibt das eine Minderheitenaktivität.
Was wir allerdings bereits sehen, ist eine Verschiebung der Grundannahmen. Flächendeckende Überwachung gilt zunehmend als normal, sich dagegen zu wehren als naiv. Im Zuge einer Klage wegen Dataminings rechtfertigt sich Google neuerdings damit, dass NutzerInnen von Gmail eh nicht erwarten würden, dass ihre E-Mails nicht von Google gelesen und analysiert würden (»a person has no legitimate expectation of privacy in information he voluntarily turns over to third parties«).
Verschlüsseln von E-Mails mit und die Verwendung von Anonymisierungsdiensten, wie Tor ist eher eine Praxis von Geeks. Glaubst Du, wird sich die Praxis jetzt mehr verbreiten?
In die breite Masse? Nein. Ich denke, dass Informationsprofis, etwa JournalistInnen, AktivistInnen etc. vorsichtiger werden und vermehrt auf die Sicherheit der Services achten, die sie nutzen. Wobei das mit der Sicherheit immer relativ ist. Welche Ressourcen/Methoden setzt ein »Angreifer« ein, um an die Daten zu gelangen?
Das kommerzielle Profiling ist einigermaßen einfach zu reduzieren, denn es arbeitet mit einem sichtbaren Tauschgeschäft. Benutzerfreundlichkeit gegen persönliche Daten. Wer bereit ist, auf Nutzerfreundlichkeit zu verzichten, der kann sich in diesem Bereich einigermaßen gut schützen.
Da reicht es teilweise, Voreinstellungen zu ändern, Add-ons zu installieren, keine Cookies zu akzeptieren, unterschiedliche Services zu nutzen etc. Nur wird dieses Tauschgeschäft von den Betreibern so gestaltet, dass der Verlust von Nutzerfreundlichkeit unmittelbar zu Buche schlägt, während der Gewinn an Datenschutz direkt kaum zu erfahren ist. In der Praxis bedeutet das, dass die meisten NutzerInnen am Ende es doch lieber bequem haben.
Gegen gezielte polizeiliche Überwachung ist das schwieriger, bei gezielter geheimdienstlicher Überwachung wohl unmöglich. Und seit Snowden wissen wir, dass auch diese letzte Form der Überwachung jeden treffen kann.
Es ist oft die Rede davon, dass wir uns eigentlich mehr Dezentralität und Alternativen wünschen würden im Zusammenhang mit der Entwicklung des Netzes. Mit den heutigen Anforderungen an Bandbreite und dem Fakt, dass Telekom und Co keine leistbaren symmetrischen Haushaltsanschlüsse anbieten (gleiche Bandbreite für up und download) wurde natürlich schon zu Anfangszeiten, als das Geschäft mit Zugang zum Internet begonnen hat, verhindert, dass wirkliche Dezentralität entstehen kann.
Damit eine dezentrale Infrastruktur entstehen kann, muss nicht jeder selbst ein Anbieter werden. Dezentralität ist zunächst eine Frage der Interoperabilität. Alle frühen Internetservices waren interoperabel und boten damit die Möglichkeit der Dezentralität. Nehmen wir etwa E-Mail, da ist es heute noch so, dass wenn ich meinen Provider wechsle, dann kann ich mein Adressbuch mitnehmen, weil E-Mail interoperabel ist. Wenn ich mein soziales Netzwerk wechsle, dann verliere ich meine Freunde, weil diese Services nicht interoperabel sind. Dahinter liegen bewusste Entscheidungen der Entwickler bzw. der Investoren. Wenn wir wieder vermehrt in Richtung Dezentralität gehen wollen, dann müssen wir die Anforderungen an die Interoperabilität erhöhen. Was wohl nicht ohne Gesetze geht, wobei ich nicht sehr optimistisch bin, dass diese auch kommen.
Eine Lösung könnte ja sein, dass jede/r seine kleine »Freedombox« als Kommunikations- und Produktionsinfrastruktur von zu Hause aus betreibt. Wie utopisch ist diese Vorstellung oder ist der Zug nicht schon längst abgefahren? Wie stellst Du Dir Dezentralität oder Alternativen vor?
Relevante Infrastrukturen zu betreiben ist ein Geschäft für Profis. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, daran alle zu beteiligen, außer man macht das so extrem redundant wie das etwa Bittorrent gemacht hat. Da spielt es dann keine Rolle mehr, wenn ein einzelner Knoten/Anbieter ausfällt.
Wichtig ist aber, dass verschiedene Anbieter miteinander in eine ernsthafte Konkurrenz treten können. Es ist eben doch ein Unterschied, ob meine E-Mail bei servus.at oder bei Google liegt, wobei an beide die Erwartung gestellt wird, dass ich meine Mail auch um 3 Uhr in der Früh abrufen kann, wenn ich das möchte.
Gehen wir mal ein bisschen weg von der Mainstream-Entwicklung des Netzes. Da sprichst du gerade Bittorrent an, das führt mich zu dem Stichwort »Darknets«. Die Technologie von Friend2friend-Netzwerken ist ja nicht neu. Projekte wie Retroshare (http://retroshare.sourceforge.net/), ein Client, den man sich plattform-unabhängig (Windos, Mac, Linux) installieren kann, würde eigentlich alles bieten, was man braucht. Verschlüsselte Kommunikation, Filesharing, Foren zwischen trusted Friends etc, etc. Es scheitert eigentlich »nur« daran, dass das Interface leider sehr schlecht ist. Könnten solche Projekte nicht einen Aufschwung erleben oder ein neues Geschäftsmodell werden?
Es gibt viele Darknets. Gerade im Filesharing sind einige Communities abgetaucht und nur noch für Mitglieder zu erreichen. Von Außen sind diese kaum mehr zu sehen und die besseren dieser »gated communities« sorgen auch dafür, dass ihre Verbindung nach Außen, etwa durch Links die nach Außen weisen, konsequent anonymisiert werden.
Darknets sind eine Konsequenz des Druckes der Kriminalisierung, der ja teilweise durchaus zu Recht besteht. Je größer die negativen Konsequenzen der Entdeckung des eigenen Handels, desto größer die Bereitschaft, etwas komplexere Tools zum Schutz der »Privatsphäre« zu nutzen. Ich denke, hier findet gerade ein Lernprozess statt, der neue Geschäftsmodelle ermöglichen könnte. Wobei das auch Risiken mit sich bringt, denn in zunehmenden Maße ist die Nutzung von Verschlüsselung selbst verdächtig und zieht erhöhtes Interesse der Behörden nach sich. Das ist für den Betreiber dieser Dienste wie auch für die Nutzer sehr riskant, wie die »freiwillige« Schließung diverser verschlüsselter E-Mail-Anbieter in den letzten Wochen gezeigt hat. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich es für sinnvoll halte, auch unkritische Kommunikation zu verschlüsseln, einfach damit verschlüsselte Kommunikation als solches nicht mehr auffällt.
Aber die Grundannahme von Darknets, deren Existenz ich als positiv sehe (im Unterschied zu Darknets des organisierten Verbrechens), ist letztlich sehr problematisch: Wir befinden uns in einer feindlichen Umgebung und in dieser müssen wird unser eigentlich legitimes Handeln verbergen. Das ist die Erfahrung einer Diktatur und nicht die eines Rechtsstaates. Diesen sollten wir aber nicht einfach aufgeben!
mur.at und servus.at sind ja selbstbetriebene Daten-Zentren für Kunst und Kulturschaffende in Österreich, die noch aus der Zeit »Access for All« stammen. Obwohl sich der Grundgedanke längst eingelöst hat, wird servus.at immer noch gerne genutzt und bildet für demokratiepolitische Prozesse (z.b.: freie Radios) eine wichtige und leistbare Basis. Überleben konnte servus.at bisher durch die finanzielle Unterstützung seiner Mitglieder, nicht gerade üppigen Förderungen und sehr viel Ehrenamt. Kommt der Vermittlung von gesellschaftspolitischen, netzpolitischen Themen im Zusammenhang mit digitaler Kultur Deiner Meinung nach heute mehr Relevanz zu, als eine solche Struktur tatsächlich selbst zu betreiben?
Es wäre wohl ein sehr positiver Effekt der ganzen Diskussion, wenn der Wert dezentraler und unabhängiger Infrastrukturen und ihrer Provider wieder verstärkt ins Bewusstsein gerufen würde und entsprechend die Bereitschaft das zu finanzieren wieder stärker würde, sei das über Spenden, Beiträge oder öffentliche Subventionen.
Die Vermittlung von netzpolitischen Themen und das Betreiben von unabhängiger Infrastruktur gehen zusammen. Denn auch bei der besten Vermittlungs-arbeit ist unser Einfluss auf die Giganten des Netzes sehr klein. Aber Vermittlungsarbeit kann den Wert von Alternativen ins Bewusstsein rufen, aber diese müssen dann auch bestehen. Insofern sind das zwei Seiten der gleichen Medaille und jedeR kann sich individuell aussuchen, auf welcher Seite er/sie lieber arbeiten will.
»Digital Natives« verwechseln ja das Internet gerne mit Facebook. Genauso wie viele NutzerInnen den Unterschied von Browser und Desktop nicht mehr kennen. Als Netzkulturinitiative schauen wir hinter Oberflächen, aber zunehmend geht dieses Wissen verloren, weil sich niemand mehr dafür interessiert. Wär es nicht an der Zeit, dass so etwas wie Netzkultur ein eigenes Schulfach ist oder gibt es derartiges schon?
Genau. Digital Natives verstehen nicht mehr von digitalen Technologien als Nicht-Natives. Im Grunde verstehen sie sogar weniger davon, denn die Technologie funktioniert ja einfach und damit wird sie unsichtbar. Werkzeuge fallen nur auf, wenn sie kaputt gehen, das wusste schon Heidegger. Es wird aber auch immer schwieriger hinter die Oberflächen zu schauen, denn die technologische Komplexität hat rasant zugenommen. Der kurze Moment der Transparenz, als es reichte, auf »view source« zu drücken um eine Website zu verstehen, ist definitiv vorbei.
Gleichzeitig gibt es mit Hacklabs durchaus auch neue Initiativen, die versuchen, hinter die Oberfäche zu blicken. Netzkultur als Fach in der Schule zu verankern finde ich keine gute Idee, denn die Gefahr, dass dabei eine von der Industrie gesponsorte »Respekt für Urheberrechte«-Veranstaltung herauskommt, ist sehr groß.
Interessanter wäre es, die Kultur des DIY und der Hacklabs in die Schule zu bringen. Wer dann politisch interessiert ist, hat vielleicht eine etwas bessere Basis, um sich mit der Gegenwart auseinander zu setzen.